Rehakliniken sollen Krankenhäuser entlasten
/in Allgemein /von ArchivDass die Bundesländer nun rechtlich in die Lage versetzt werden, Vorsorgeeinrichtungen und Rehakliniken für die akutstationäre Behandlung von Patientinnen und Patienten auszuwählen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. In dieser Krisensituation brauchen wir jedoch genau wie für die Krankenhäuser einen wirksamen finanziellen Schutzmechanismus für Rehakliniken, um Erlösausfälle auszugleichen.
Die Bundesregierung unterstützt mit dem heute vom Kabinett beschlossenen COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Krankenhäuser, um die Versorgungskapazitäten für eine wachsende Anzahl von Patienten mit einer Coronavirus-Infektion bereitzustellen. Dazu erhalten Krankenhäuser einen finanziellen Ausgleich für verschobene planbare Operationen und Behandlungen. Für jedes Bett, das dadurch im Zeitraum vom 16. März bis zum 30. September 2020 nicht belegt wird, erhalten die Krankenhäuser eine Pauschale in Höhe von 560 Euro pro Tag. Der Ausgleich wird aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der aus dem Bundeshaushalt refinanziert wird, bezahlt.
Diese Zahlung ist allerdings nicht für Rehakliniken vorgesehen. Das neue Gesetz sieht stattdessen vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen Krankenhausleistungen zur Entlastung der Krankenhäuser erbringen können, die entsprechend abgegolten werden. Außerdem sollen Krankenhäuser beim Angebot der Kurzzeitpflege durch Rehakliniken entlastet werden können, sodass auch dort Betten belegt werden.
Die Rehakliniken in unserer Heimatregion genießen nicht nur international einen ausgezeichneten Ruf, sondern sie werden auch von sehr vielen Menschen vor Ort genutzt, die Krankenkassenbeiträge bezahlen. Sie haben einen Anspruch darauf, dass die gute medizinische Versorgung im ländlichen Raum in Krisenzeiten und danach erhalten bleibt. Deshalb müssen Einrichtungen der Kinder- und Jugend-Reha, Vorsorge- und Rehakliniken für Mütter, Väter und Kinder sowie Privatkliniken mit einer Zulassung nach § 30 GewO Ausgleichszahlungen erhalten, um die die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzufedern.
Reha-Einrichtungen müssen mit starken Belegungsschwankungen rechnen, wenn Krankenhäuser wie in der vergangenen Woche angekündigt planbare Operationen verschieben oder ganz absagen. Der angekündigte Operationsstopp ist richtig, um die Intensivkapazitäten in Krankenhäusern zu erhöhen. Er wird aber kurzfristig auf die Reha-Einrichtungen durchschlagen, die die Anschlussversorgung frisch Operierter übernehmen.
Die SPD-Politikerin hatte sich bereits am Vortag an Bundesgesundheitsminister Spahn persönlich gewandt mit dem Appell, dass Rehakliniken sofort und genau wie die Krankenhäuser einen Rettungsschirm für die vorsorglich herunterzufahrenden „normalen“ Behandlungsfälle brauchen.
Weitere Informationen unter:
Virtuelle Bürgersprechstunde per Telefon und soziale Medien
/in Allgemein /von ArchivAus aktuellem Anlass rund um das Corona-Virus bietet ich am morgigen Dienstag, den 17.03.2020 und dem kommenden Donnerstag, 19.03.2020 Bürgerinnen und Bürgern eine Bürgersprechstunde per Telefon an.
Unser aller Alltag wird durch die derzeitige Ausbreitung des Coronavirus durcheinandergewirbelt. Auch beim Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist jetzt ein Umdenken erforderlich. Mit einer Bürgersprechstunde per Telefon und sozialen Medien möchte ich den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, trotz Coronavirus Ihre Anliegen und Fragen zu allen politischen Themen an mich heranzutragen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, den Menschen ein Angebot zum politischen Austausch zu unterbreiten.
Telefonsprechstunden (07751 – 9176881):
- Dienstag, den 17.03.2020 von 10 Uhr bis 11 Uhr
- Dienstag, den 17.03.2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr
- Donnerstag, den 19.03.2020 von 10 Uhr bis 11 Uhr
- Donnerstag, den 19.03.2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr
Virtuelle Sprechstunde via Facebook (www.facebook.de/schwarzeluehrsutter)
- Mittwoch, den 18.03.2020 von 10 bis 12 Uhr.
Rita Schwarzelühr-Sutter – Newsletter 05 / 2020
/in Allgemein /von ArchivSchutzschirm für Arbeitsplätze
Durch die Corona-Krise soll in Deutschland möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. Der Bundestag hat am Freitag beschlossen, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern, wenn Unternehmen wegen des Corona-Virus vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen.
Den Entwurf eines Gesetzes zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld hatten die Koalitionsfraktionen kurzfristig in den Deutschen Bundestag eingebracht. Die Maßnahmen sind ein Ergebnis des Koalitionsausschusses vom vergangenen Sonntag. Damit die Regelungen zügig in Kraft treten können, wurde die Tagesordnung des Bundestages kurzfristig geändert.
Mit dem Gesetz werden bestehende Instrumente ausgebaut und auf die Krise angepasst, um auf wirtschaftliche Einbrüche richtig reagieren zu können und Arbeitsplätze zu sichern. „Wir wollen die Auswirkungen der Krise auf die arbeitenden Menschen und die Volkswirtschaft eindämmen“, sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. „Deshalb spannen wir einen Schutzschirm für Arbeitsplätze.“
Kurzarbeit erleichtern
Schon heute zeigt die Ausbreitung des Corona-Virus wirtschaftliche Folgen: Lieferschwierigkeiten, Arbeitsausfälle, weniger Konsum. Noch ist unklar, wie stark die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Beschäftigten sein werden. Klar ist allerdings: Die Politik muss sich darauf vorbereiten. Hubertus Heil: „Unser Ziel ist es, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden und entschlossen und frühzeitig zu handeln.“
Um Entlassungen zu vermeiden, soll der Zugang für den Bezug von Kurzarbeitergeld künftig durch die Bundesregierung wesentlich erleichtert werden können:
Bisher muss mindestens ein Drittel der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sein, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Diese Schwelle kann bis auf zehn Prozent abgesenkt werden.
Das geltende Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt werden und ins Minus gefahren werden. Darauf soll teilweise oder vollständig verzichtet werden können.
- Kurzarbeitergeld kann auch für Beschäftigte in Leiharbeit ermöglicht werden.
- Der Bundesagentur für Arbeit wird die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge ermöglicht.
- Die entsprechenden Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung gelten bis Ende 2021. Die Verordnungen selbst sind zunächst befristet.
Schutz und Chancen im Wandel
Beschäftigte sollen beim Strukturwandel der Wirtschaft noch stärker unterstützt werden. Dafür haben die Koalitionsfraktionen den Entwurf eines „Arbeit von morgen“-Gesetzes in den Bundestag eingebracht. Durch eine bessere Förderung von Weiterbildung soll es dafür sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können.
Prozesse wie die Digitalisierung oder der ökologische Umbau des Wirtschaftssystems verändern die Arbeitswelt und bringen neue Herausforderungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass alle mithalten können und auch in Zukunft gute Arbeit haben. Wenn sich die Anforderungen an den Job ändern, brauchen die Beschäftigten Möglichkeiten zur Weiterbildung, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Mit dem geplanten „Arbeit von morgen“-Gesetz sollen Beschäftigte und Betriebe im Strukturwandel noch besser unterstützt werden. Ziel ist es, Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern und die hohe Wertschöpfung der Wirtschaft zu erhalten. Und wenn Menschen dennoch ihre Arbeit verlieren, sollen sie über Weiterbildung und Qualifizierung möglichst schnell wieder Arbeit bekommen.
Konkret sieht der Gesetzentwurf unter anderem vor, dass die Bundesagentur für Arbeit die berufliche Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäftigten, die vom Strukturwandel betroffen sind, noch stärker fördern kann als bisher. Die entsprechenden Zuschüsse zu Lehrgangskosten und Arbeitsentgelt sollen hierfür unabhängig von der Betriebsgröße um jeweils zehn Prozentpunkte erhöht werden, wenn mindestens jeder fünfte Beschäftigte eines Betriebes Weiterbildung braucht. Außerdem sollen Beschäftigte in Transfergesellschaften besser gefördert und qualifiziert werden. Damit soll der Übergang in eine neue Beschäftigung unterstützt werden, unabhängig vom Alter und Berufsabschluss. Und es soll einen Anspruch auf Förderung einer beruflichen Weiterbildung geben, die darauf abzielt, einen Berufsabschluss zu erreichen.
Das „Arbeit von morgen“-Gesetz richtet die Arbeitsmarkt-Instrumente klar auf ein Ziel aus: Beschäftigung und Sicherheit für alle.
Rechtsextremismus und Hasskriminalität bekämpfen
Mit einem Gesetz will die Koalition gegen Hasskriminalität im Internet vorgehen. Wer im Netz hetzt und droht, soll künftig härter und effektiver verfolgt werden.
Mehr als drei Viertel aller von der Polizei registrierten Hasskommentare sind rechtsextremistisch. Und nicht selten werden aus diesen Worten auch Taten. Im Schnitt kommt es jeden Tag zu zwei rechtsextremen Gewalttaten in unserem Land. Das gesellschaftliche und politische Klima hat sich grundlegend verändert. Rassismus und Rechtsextremismus führen zu Hass. Hass führt zu Bedrohungen und diese Bedrohungen führen zu Gewalt.
„Wir schauen nicht tatenlos zu, wie sich Hass und Hetze im Internet ausbreiten, denn die Morde in Hanau, Halle und Kassel zeigen, wie schnell aus Worten Taten werden“, sagt der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner. Der Bundestag hat deshalb am Donnerstag in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur „Bekämpfung von Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ beraten.
Höhere Strafen und konsequente Strafverfolgung
Mit dem Gesetzentwurf will die Koalition das Strafrecht verschärfen und dafür sorgen, dass Hetze und Bedrohung im Netz künftig härter und effektiver verfolgt werden können. Künftig soll der Strafrahmen bei Mord- und Vergewaltigungsdrohungen im Netz von bis zu einem auf bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe verdreifacht werden. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sollen vor Diffamierungen und Anfeindungen geschützt werden. Antisemitische Motive sollen ausdrücklich strafverschärfend wirken.
Auch die Plattformen, auf denen Hasskommentare veröffentlicht werden, werden weiter in die Pflicht genommen: Sie sollen künftig nicht mehr nur löschen, sondern bestimmte strafbare Postings wie Volksverhetzungen, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sowie Neonazi-Propaganda dem Bundeskriminalamt melden. Das gilt auch für Fälle, in denen Frauen mit Vergewaltigungsfantasien bedroht werden. Denn Hass und Hetze im Netz zielen besonders auf Frauen und dabei besonders häufig auf Frauen mit Migrationshintergrund. Ziel der Koalition ist es, all diese Hass-Straftaten konsequent vor Gericht zu bringen.
Engagierte Menschen besser schützen
Das betrifft auch Drohungen gegenüber Menschen, die sich politisch oder gesellschaftlich engagieren. Anfeindungen und Einschüchterungsversuche sind für viele Engagierte trauriger Alltag geworden. Für die SPD-Fraktion ist klar: Unsere Demokratie gerät in Gefahr, wenn sich Bürgerinnen und Bürger aufgrund von Drohungen aus Vereinen, Initiativen oder der örtlichen Politik zurückziehen müssen.
Der Gesetzentwurf sieht deshalb unter anderem Änderungen im Melderecht vor. Es soll verhindert werden, dass private Adressen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern oder gesellschaftlich Engagierten gezielt im Netz veröffentlicht werden können. Künftig können gefährdete Personen leichter eine Auskunftssperre eintragen lassen und so davor geschützt werden, dass ihre Adressen weitergegeben werden.
Außerdem soll klargestellt werden, dass der besondere Schutz von Personen des politischen Lebens vor übler Nachrede und Verleumdung auch für Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen gilt. „Angriffe auf diese politisch Engagierten nehmen zu“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl. „Diese Angriffe sind Angriffe auf unsere Demokratie. Wir lassen das nicht zu, deshalb bringen wir das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität jetzt auf den Weg.“
Anti-IS-Mandat soll verändert werden
Auf Initiative der SPD-Fraktion beteiligen sich deutsche Tornados künftig nicht mehr an der Luftraumüberwachung im Irak. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Anti-IS-Koalition soll in veränderter Form fortgesetzt werden. Über einen entsprechenden Antrag der Bundesregierung hat der Bundestag am Freitag erstmals beraten.
Im Oktober 2019 hatte der Bundestag auf Initiative der SPD-Fraktion beschlossen, die Luftraumüberwachung im Irak durch deutsche Tornados zum 31. März 2020 zu beenden. Dieser Beschluss soll jetzt umgesetzt werden, indem Italien die deutschen Tornados ersetzen wird.
Der deutsche Einsatz soll in angepasster Form fortgesetzt werden. Auch wenn im Kampf gegen die Terrororganisation IS große Fortschritte erzielt worden sind, ist der IS nicht besiegt. Um nachhaltige Erfolge beim Kampf gegen den IS zu gewährleisten, soll der Einsatz „Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und Syrien“, der im Oktober 2019 von Bundestag beschlossen wurde, auf Antrag der Bundesregierung ergänzt werden:
Um den steten Verfolgungsdruck auf den IS sicherzustellen, muss der Kampf gegen den IS aus der Luft fortgesetzt werden. Daher soll die bisherige deutsche Unterstützung in Form von Luftbetankung auch über den 31. März 2020 hinaus fortgesetzt werden.
Die beteiligten Kräfte der Bundeswehr werden Lufttransporte für die internationale Anti-IS-Koalition, internationale Organisationen, Alliierte und Partner durchführen. Dies ist besonders wichtig, um den Transport von Truppen in die Einsatzländer hinein, innerhalb des Landes, und in Krisensituation zum Schutz der Soldaten aus dem Land heraus zu sichern.
Außerdem beinhaltet der deutsche Beitrag ein Luftraumüberwachungsradar im Irak, der die internationale Anti-IS-Koalition und die irakischen Luftfahrtbehörden bei Luftraumkoordinierungsmaßnahmen unterstützt.
Der bisher durchgeführte Aufbau von Fähigkeiten der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte hat bereits Erfolge gezeitigt und soll daher ebenfalls fortgesetzt werden. Das irakische Parlament hatte sich zwar im Januar 2020 zunächst dafür ausgesprochen, die Präsenz ausländischer Truppen im Irak zu beenden. Allerdings hatte die irakische Regierung schon sehr bald deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse daran hat, dass das internationale Engagement im Kampf gegen IS im Irak fortgeführt wird. Auf Grundlage der Zustimmung der irakischen Regierung soll die Beteiligung der deutschen Bundeswehr an der Ausbildung der irakischen Streitkräfte im Zentralirak künftig auch im Rahmen der NATO-Mission im Irak erfolgen können. Die Befristung des gesamten Einsatzes bis zum 31. Oktober 2020 soll bestehen bleiben.
Afghanistan unterstützen
Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der Nato-geführten Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsmission „Resolute Support“ in Afghanistan. Das hat der Bundestag auf Antrag der Bundesregierung beschlossen.
Das gemeinsame Engagement der afghanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft hat in den letzten Jahren trotz vieler Schwierigkeiten greifbare Ergebnisse hervorgebracht: Lebenswichtige Transport- und Versorgungsinfrastruktur wurde wieder hergestellt, das Bildungssystem und die Gesundheitsversorgung haben sich grundlegend verbessert, Frauen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle im öffentlichen Leben, und es gibt eine vielfältige Medienlandschaft sowie freie politische Debatten.
Allerdings sind auf all diesen Feldern weitere Anstrengungen nötig, damit Afghanistan den Rückstand aufholen kann, der in den Jahrzehnten bewaffneter Konflikte entstanden ist. Denn gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie brüchig bereits erzielte Fortschritte weiterhin sind. Die Regierung ist nicht in allen Landesteilen handlungsfähig; Korruption und Armut sind immer noch weit verbreitet.
Auftrag der Mission bleibt es deshalb, die Leistungsfähigkeit der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu erhöhen. Ziel ist es, die afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, die Sicherheitsverantwortung auf lange Sicht flächendeckend und eigenverantwortlich wahrzunehmen. Darüber hinaus sieht das Mandat vor, dass die Bundeswehr im Notfall auch Personal der internationalen Gemeinschaft, das im zivilen Wiederaufbau engagiert ist, unterstützen kann.
Die Einigung zwischen den USA und den Taliban sieht eine Verringerung der Truppenpräsenz der internationalen Staatengemeinschaft vor und wird dazu beitragen können, Vertrauen auf beiden Seiten zu bilden. Diese Anpassung, die die amerikanischen Streitkräfte nun vornehmen, wird auch bedeuten, dass eine behutsame Anpassung der deutschen Präsenz erforderlich wird. Über die konkrete Ausgestaltung stimmt sich Deutschland deshalb mit den internationalen Partnern eng ab. Die Obergrenze von 1300 deutschen Soldatinnen und Soldaten bis zum 31. März des nächsten Jahres wird zunächst unverändert beibehalten, um die dabei notwendige Flexibilität zu wahren.
Darfur-Einsatz wird reduziert
Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der Friedensmission der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union in der sudanesischen Region Darfur, allerdings mit weniger Soldatinnen und Soldaten als bisher. Einem entsprechenden Mandat hat der Bundestag zugestimmt.
Nach der Absetzung des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir durch das Militär im April 2019, befindet sich der Sudan in einer fragilen Umbruchsphase. Die neue Regierung hat einige deutliche Zeichen gesetzt, dass sie mit der Vergangenheit brechen will.
Die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes bringt die deutsche Unterstützung des Transformationsprozesses in dem Land zum Ausdruck und entspricht dem Wunsch der Übergangsregierung nach Verlängerung der UNAMID-Mission. Diese Mission hat unter anderem die Aufgabe, Zivilpersonen zu schützen, die Einhaltung der Menschenrechte zu beobachten beziehungsweise über ihre Missachtung zu berichten, humanitäre Hilfe zu erleichtern und die Sicherheit des humanitären Personals zu gewährleisten.
Es liegt im deutschen Interesse, die neue sudanesische Regierung in ihrem Streben nach einer dauerhaften Lösung des Darfur-Konflikts auch weiterhin zu unterstützen. Das deutsche Engagement leistet einen Beitrag zur Stabilität in der Sudan-Sahel-Region und entspricht den Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, denen Konfliktbewältigung und Friedensförderung zu Grunde liegen.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beabsichtigt, bis zum 31. März 2020 einen Beschluss über einen verantwortungsvollen Abbau hin zu einem Ausstieg aus UNAMID zu fassen und in Abhängigkeit von dieser Entscheidung im Einvernehmen mit der sudanesischen Regierung eine Folgepräsenz zu mandatieren.
Da Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Friedensprozesses in Darfur und mit Blick auf eine vom Sicherheitsrat geplante Folgemission bleiben, hat der Bundestag einer Verlängerung des Bundeswehreinsatzes bis zum 31. Dezember 2020 zugestimmt. Der deutsche militärische Beitrag wird wie bisher vor allem darin bestehen, dass sich Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission beteiligt. Die Truppenobergrenze wird von 50 auf 20 Soldatinnen und Soldaten reduziert.
Engagement im Südsudan wird fortgesetzt
Die Beteiligung der Bundeswehr an der von den Vereinten Nationen geführten Friedensmission im Südsudan (UNMISS) wird verlängert. Das hat der Bundestag auf Antrag der Bundesregierung beschlossen.
Auch neun Jahre nach seiner Unabhängigkeit hat der Südsudan keinen Frieden gefunden und bleibt auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Zwar haben sich die Bürgerkriegsparteien im September 2018 auf ein Friedensabkommen geeinigt, doch die Sicherheitslage bleibt fragil. Zudem sind von gut zwölf Millionen Einwohnern mehr als sieben Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen; rund 1,5 Millionen Menschen sind binnenvertrieben und ca. 2,2 Millionen Menschen in die Nachbarstaaten geflüchtet.
Schwerpunkt der Friedensmission bleibt der Schutz der Zivilbevölkerung. Der deutsche militärische Beitrag besteht weiterhin in der Beteiligung von Einzelpersonal in Führungsstäben der Mission sowie in Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungsoffizieren. Das Bundeswehrmandat wird bis zum 31. März 2021 verlängert. Wie bisher können bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden.
Mittelmeerraum stabilisieren
Die Bundeswehr leistet weiterhin einen Beitrag zum Kampf gegen Terrorismus und Waffenschmuggel im Mittelmeer. Der Bundestag hat einem entsprechenden Antrag der Bundesregierung zugestimmt.
Rund ein Drittel aller über See verschifften Güter und ein Viertel aller Öltransporte weltweit werden durch das Mittelmeer geleitet. Daher ist die Sicherheit im Mittelmeerraum für die Nato und ihre Mitgliedsländer von zentraler Bedeutung. Fehlende staatliche Kontrolle über weite Küstenbereiche des Mittelmeerraumes und anhaltende politische Instabilität in einzelnen Staaten eröffnen terroristischen Organisationen jedoch Rückzugs- und Herrschaftsräume.
Die Beteiligung der Bundeswehr an der Nato-geführten Maritimen Sicherheitsoperation „Sea Guardian“ wird daher um ein weiteres Jahr bis Ende März 2021 verlängert. Wie im vergangenen Jahr sollen bis zu 650 deutsche Soldatinnen und Soldaten daran mitwirken, Lagebilder zu erstellen und den Seeraum zu überwachen. Das Einsatzgebiet umfasst das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar und ihre Zugänge sowie den darüber liegenden Luftraum.
Ehrenamt beim THW wird gestärkt
80.000 Helferinnen und Helfer engagieren sich beim Technischen Hilfswerk (THW) ehrenamtlich für den Zivil- und Katastrophenschutz. Auf Initiative der Koalition wird die Attraktivität dieses Ehrenamtes gestärkt.
Hierzu hat der Bundestag am Freitag das Zweite Gesetz zur Änderung des THW-Gesetzes beschlossen. Es zielt darauf ab, die Regelungen des THW-Gesetzes zu aktualisieren und mit rechtlichen Verbesserungen im Ehrenamt zu verbinden.
Neue Gefahren wie etwa die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen oder der Klimawandel führen zu veränderten Rahmenbedingungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Das THW stellt sich diesem Wandel, in dem es beispielsweise seine technischen Fähigkeiten erweitert oder seine technischen und logistischen Strukturen modernisiert. Die Modernisierung des THW-Gesetzes soll diesen Entwicklungen Rechnung tragen. Außerdem werden unter anderem Freistellungsregelungen zur Förderung der Helferinnen und Helfer verbessert.
Durch eine Änderung am Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren wollen die Koalitionsfraktionen zudem die Zahl der Einsätze des THW steigern, die im Rahmen der Amtshilfe auf Ersuchen von Gefahrenabwehrbehörden durchgeführt werden. Wenn ein solcher Einsatz im öffentlichen Interesse liegt, kann auf eine Kostenerstattung an das THW durch die Gefahrenabwehrbehörde unter bestimmten Voraussetzungen verzichtet werden. Der dafür erforderliche finanzielle Mehrbedarf wird durch den Bund bereitgestellt.
Information für die Menschen am Hochrhein und im Hochschwarzwald

Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität
 Titlfoto: Pixabay
Titlfoto: PixabayNeubau der Luftmessstation auf dem Schauinsland
 KDFB
KDFBKlimapaket Thema beim Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB)

Mobiles Breitband: Vodafone nimmt LTE-Mobilfunkstandort in Oberhöllsteig/ Breitnau in Betrieb
Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität
/in Allgemein /von ArchivGrenze zur Schweiz geschlossen
Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Bundesregierung sich dazu entschieden, mit beginn am 16.03.2020 ab 08.00 Uhr die gemeinsamen Grenzen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich zu schließen. Der Schutz der Bevölkerung hat höchste Priorität. eine solche Pandemie gab es in den letzten 100 Jahren nicht mehr. Deshalb halte ich diesen heftigen Einschnitt in unser Leben, unsere Arbeit und die Wirtschaft für gerechtfertigt. Die Grenzgänger in die Schweiz erhalten eine Ausnahme, insbesondere die in kritischen Infrastrukturen, als Pflegekräfte oder als medizinisches Personal in der Schweiz arbeiten. Sie dürfen weiterhin die Grenze passieren, um zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Dennoch stelle die Grenzschließung zur Schweiz einen besonderen Einschnitt für unsere Region dar. Gerade der Einzelhandel werde von dieser Regelung schwer getroffen.
Deshalb war es wichtig, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier am vergangenen Freitag wichtige Finanzhilfen für Unternehmen angekündigt haben. Auch die am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Regelungen zum Kurzarbeitergeld sollen dabei helfen, Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen in dieser schwierigen Zeit Planungssicherheit zu geben. Auch wenn sich die vorläufige Grenzschließung massiv auf die heimische Wirtschaft auswirken wird, geht in diesen Zeiten die Gesundheit vor.
In dieser speziellen Situation möchte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger noch mal dazu aufrufen, sich solidarisch, insbesondere mit älteren Menschen, zu zeigen und sofern es die eigenen Möglichkeiten zulassen, Hilfe im Alltag anzubieten z.B. bei Einkaufsgängen. Gegenseitige Hilfe ist jetzt besonders wichtig.
Auch möchte ich an dieser Stelle noch mal auf die aktuellen Informationen verweisen, die Bundesregierung, Bundesgesundheitsministerium und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihren Internetauftritten zur Verfügung stellen.
Auf die Grenzschließung hatten sich Kanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Spahn, Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Länderchefinnen und -chefs der angrenzenden Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland am heutigen Sonntag geeinigt.
Titelfoto: Büro Schwarzelühr-Sutter
Neubau der Luftmessstation auf dem Schauinsland
/in Allgemein /von ArchivDas Umweltbundesamt (UBA) plant auf dem 1205 Metern hoch gelegenen Schwarzwaldberg Schauinsland bei Freiburg den Bau einer neuen Messstation. Das bestehende Gebäude aus dem Jahr 1942 wird in den nächsten zwei bis drei Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Kosten beziffern sich auf vier Millionen Euro. Damit wir auch in Zukunft genauestens über die Schadstoffbelastung Bescheid wissen, ist der Neubau der Messstation eine sehr gute Investition seitens des Umweltbundesamtes.
Der Standort ist nach der Zugspitze in Bayern die zweithöchste Luftmessstation in Deutschland. Die Station dient der Beobachtung und Überwachung der Luft im Rahmen nationaler und internationaler Luftreinhalteabkommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Erfassung langfristiger Entwicklungen. Für Kohlenstoffdioxid existiert am Schauinsland die längste Messreihe Europas (1972 bis heute). Diese Arbeit wird auch mit Blick auf den Klimawandel fortgeführt.

Foto: Rita Schwarzelühr-Sutter und die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Inge Paulini, bei der Einweihung eines neuen Messgeräts für die Radioaktivitäts-Messstation auf dem Schauinsland im Jahr 2018. © Christian Horn.
Klimapaket Thema beim Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB)
/in Allgemein /von ArchivAuf Einladung der Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Dr. Maria Flachsbarth, habe ich berichtet, welche Maßnahmen im Klimapaket der Bundesregierung enthalten sind.
Der Katholische Deutsche Frauenbund setzt sich seit vielen Jahren für die Bewahrung der Schöpfung ein und engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung. Dazu zählen sowohl der verbesserte Klimaschutz als auch ein bewusster Umgang mit Energie und Lebensmitteln, besonders aber die Vermeidung von Plastikmüll. Der KDFB ist ein bedeutender gesellschaftlicher Akteur, der Verantwortung übernimmt. Wir wissen, dass Frauen stärker vom Klimawandel betroffen sind insbesondere in Entwicklungsländern. Frauen sind aber nicht nur Leidtragende des Klimawandels, sondern sind vor allem auch aktiv Mitwirkende bei Klimaschutzmaßnahmen. Klimaschutz ist nur dann erfolgreich, wenn alle mitmachen, auf allen politischen Ebenen und gesellschaftlichen Organisationen. Dies erfordert einen regelmäßigen Austausch und Dialog, die auch der Katholische Deutsche Frauenbund fortlaufend anstößt.
Neben der aktuellen Klimapolitik wurde in dem Gespräch auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Kirche und der Gesellschaft insgesamt thematisiert.
Mit den Aktionen ‚Maria 2.0‘ und ‚Maria, schweige nicht!‘ hat der Katholische Deutsche Frauenbund eine wichtige Debatte in der Kirche angestoßen. Frauen sind fester Bestandteil einer glaubwürdigen Kirche und gestalten aktiv das Gemeindeleben. Ich unterstütze das wichtige Engagement des KDFB dafür, dass Frauen und Männer gleichberechtigt Verantwortung, auch geistliche Verantwortung, übernehmen.
Mobiles Breitband: Vodafone nimmt LTE-Mobilfunkstandort in Oberhöllsteig/ Breitnau in Betrieb
/in Allgemein /von ArchivDie Vodafone GmbH hat einen neuen Mobilfunkstandort in Oberhöllsteig (Gemeinde Breitnau) in Betrieb genommen. Das teilte die Geschäftsführung des Unternehmens der SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter schriftlich mit. Die Investitionskosten für die Inbetriebnahme der mobilen Breitbandtechnologie LTE (Long Term Evolution, auch als „4G“ bekannt) habe Vodafone aus eigenen Mitteln getragen.
Der Breitbandausbau schreitet voran. Nicht nur im Festnetz, sondern auch im Mobilfunk haben die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum ein Anrecht auf eine hochleistungsfähige Infrastruktur. Deshalb begrüße ich es, dass Vodafone in Breitnau einen konkreten Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Heimatregion leistet.
Die Bundesnetzagentur hat in der Zuteilung der im Jahr 2015 versteigerten Frequenzen Auflagen gemacht, dass die Mobilfunknetzbetreiber ab dem 1. Januar 2020 98% der Haushalte bundesweit und 97% der Haushalte je Bundesland mit einer Mindestdatenrate von 50 MBit/s pro Antennensektor zu versorgen haben. Überdies sind die Hauptverkehrswege vollständig zu versorgen.
Titelbild: pixabay
Rita Schwarzelühr-Sutter – Newsletter 04 / 2020
/in Allgemein /von ArchivKohleausstieg: Klima schützen, Beschäftigte absichern
Bis spätestens 2038 wird Deutschland schrittweise aus der Kohleverstromung aussteigen. Das regelt das Kohleausstiegsgesetz, das der Bundestag am Freitag in erster Lesung beraten hat.
Es ist ein bedeutender Schritt für mehr Klimaschutz: Mit einem klaren, verbindlichen Fahrplan wird Deutschland spätestens zum Jahr 2038 komplett aus der Kohleverstromung aussteigen. So ist es im Entwurf der Bundesregierung für das Kohleausstiegsgesetz festgehalten, den der Bundestag am Freitag in erster Lesung beraten hat. Die Koalition folgt mit dem Ausstiegsplan der Kohlekommission, die vor einem Jahr mit einem breiten Konsens Empfehlungen vorgelegt hatte.
Der Ausstieg beginnt sofort
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Ausstieg aus der Stein- und Braunkohleverstromung sofort beginnt und bis spätestens 2038 abgeschlossen ist. Noch im Jahr 2020 soll der erste Block eines Braunkohlekraftwerks vom Netz gehen. Bis 2030 soll die Leistung von Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken auf weniger als die Hälfte der heutigen Leistung sinken. „Deutschland steigt verbindlich aus der Kohlekraft aus. Das ist ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz, denn damit werden Schritt für Schritt rund ein Viertel der gesamten deutschen CO2-Emissionen eingespart“ sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. In den Jahren 2026, 2029 und 2030 soll zudem überprüft werden, ob der endgültige Ausstieg bereits drei Jahre früher erfolgen kann, in diesem Fall wäre bereits 2035 Schluss mit der Kohleverstromung. Dies ist im Wesentlichen abhängig von dem Ausbau der Erneuerbaren, mit dem Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sichergestellt werden. Mit dem Gesetzentwurf stellt die Koalition sicher, dass die von Deutschland eingesparten Emissionen nicht an anderer Stelle in Europa emittiert werden, sondern die CO2-Zertifikate vom Markt genommen werden. Nur so wirkt der Kohleausstieg voll und ganz für den Klimaschutz.
Anpassungsgeld und frühere abschlagsfreie Rente
Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es besonders wichtig, dass der Kohleausstieg sozial ausgeglichen stattfindet. Die Kohle ist bis heute in einigen Regionen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Umso wichtiger ist ein planbarer und verlässlicher Kohleausstieg, der Strukturbrüche vermeidet. Dafür hat die Koalition bereits das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen auf dem Weg gebracht, mit dem der Bund insgesamt 40 Milliarden Euro für die Strukturförderung bereitstellen wird. Die betroffenen Regionen erhalten die nötigen Mittel, um den Strukturwandel aktiv und nachhaltig zu gestalten. Ziel ist es, neue wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen zu entwickeln und neue Strukturen aufzubauen, bevor die alten endgültig wegfallen.
Mit dem Kohleausstiegsgesetz werden auch die direkten sozialen Folgen des Aussteigs für die Beschäftigten abgefedert: Der Gesetzentwurf sieht ein Anpassungsgeld für besonders betroffene ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 58 Jahre vor. Sie können dieses für bis zu fünf Jahre erhalten und anschließend in Rente gehen – die Abschläge trägt der Bund. Jüngere Beschäftigte profitieren von dem seit 1. Januar 2019 geltenden Qualifizierungschancengesetz, das die Weiterbildungsförderung für vom Strukturwandel betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessert und neue Qualifikationen ermöglicht. Mit dem vom Bundesarbeitsministerium geplanten Arbeit-von-morgen-Gesetz sollen weitere arbeitsmarktpolitische Instrumente dabei helfen, Transformation und Strukturwandel zu bewältigen.
Kein Kohleausstieg ohne Ausbau der Erneuerbaren
Die Welt schaue genau hin, wie Klimaschutz und Kohleausstieg in Deutschland gelingen, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. „Wir zeigen damit, wie ein Industrieland von der Kohleverstromung vollständig auf erneuerbare Energien umsteigt und zugleich neue wirtschaftliche Perspektiven für die Kohleregionen schafft.“ Darum sei der soziale Ausgleich nicht nur eine gute Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch in den Klimaschutz.
Der Kohleausstieg ist die Grundlage dafür, dass wir unsere Klimaziele bis 2030 und darüber hinaus einhalten können. Als einziges Industrieland der Erde steigt Deutschland gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohleverstromung aus. Das heißt gleichzeitig: Es braucht einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die Stromnetze müssen entsprechend modernisiert und ausbaut werden. Die Koalition wird hierzu das Erneuerbare-Energien-Gesetz novellieren und dabei vor allem den Ausbau der Windkraft an Land und die Förderung von Photovoltaikanlagen in den Blick nehmen.
Das Wichtigste zusammengefasst:
Mit dem Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz legt die Bundesregierung einen verbindlichen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung vor und folgt damit den Empfehlungen der Kohlekommission. Zusammen mit dem Strukturstärkungsgesetz sorgt es dafür, dass Deutschland bis 2038 aus der Kohle aussteigt, soziale Folgen für die betroffenen Beschäftigten abgefedert werden und neue wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen in den betroffenen Regionen entstehen.
Internationaler Frauentag: Erkämpftes erhalten, Fortschritt gestalten
Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat der Bundestag am Freitag die Frage debattiert, wo wir heute in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern stehen.
Trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren haben Frauen in zentralen Bereichen der Gesellschaft noch immer nicht die gleichen Chancen wie Männer. Um das zu ändern, setzt die SPD-Bundestagsfraktion zum Beispiel auf mehr Frauen in Führungspositionen und die gleiche Repräsentation von Frauen in den Parlamenten. Darum ist es den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig, dass bei der anstehenden Reform des Wahlrechts eine Parität in den Wahllisten eingeführt wird.
„Gleichstellung ist kein Naturgesetz“
„Von mehr Gleichstellung profitieren nicht nur die Frauen, sondern es kommt allen in der Gesellschaft zugute“, sagte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey in der Bundestagsdebatte. Als wichtigen Schritt bezeichnete sie es, dass es in diesem Jahr erstmals eine Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung geben werde. „Wir wollen ermöglichen, dass Frauen die gleichen Chancen in Wirtschaft, Politik und Familie bekommen, dass Väter und Mütter sich gemeinsam um Kinder und Haushalt kümmern können, dass sie aber auch Familie und Pflege mit dem Beruf vereinbaren können.“
Gleichstellung sei kein Naturgesetz, wir müssten etwas dafür tun. Das zeige auch der Frauenanteil im Bundestag, der mit der letzten Wahl sogar gesunken sei und nur noch knapp über 30 Prozent betrage. Es brauche mehr Frauen in der Politik, aber auch in Spitzenpositionen der Wirtschaft. Franziska Giffey betonte aber auch, dass es für Fortschritte in Sachen Gleichstellung immer auch Männer brauche, die sich für das Thema engagieren: „Gleichstellung funktioniert immer nur in Partnerschaftlichkeit.“
Parität durch Wahlrechtsreform
Es gehe heute auch darum, beim Thema Gleichstellung einen gesellschaftlichen Rollback weltweit zu verhindern, sagte Josephine Ortleb. „Wir müssen Erkämpftes erhalten und Fortschritte gestalten.“ Noch immer seien Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts in allen Gesellschaften häufiger von Diskriminierung und Gewalt betroffen. „Und was wir von der Wirtschaft fordern, müssen wir politisch vorleben“, betonte sie. Die SPD-Bundestagsfraktion habe hier mit ihrem Vorschlag für eine Wahlrechtsreform die Tür für die Parität durch das Wahlrecht geöffnet. Der Vorschlag sieht vor, für die nächste Bundestagswahl nur Parteien zuzulassen, deren Landeslisten paritätisch abwechselnd mit einer Frau und einem Mann oder umgekehrt besetzt sind. „Das ist keine Diskriminierung von Männern“, sagte Josephine Ortleb. „Das nennt man Gleichberechtigung.“
Erwerbs- und Sorgearbeit gerecht verteilen
Frauenpolitik bedeute, den großen Berg an Benachteiligungen von Frauen mit unterschiedlichen Werkzeugen abzubauen, sagte Leni Breymaier. Als eine zentrale Aufgabe nannte sie die gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit und der unbezahlten Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. „Wenn Frauen 75 Prozent der Sorgearbeit stemmen, ist an echte Gleichberechtigung nicht zu denken.“ Denn wenn Frauen mehr bezahlte Arbeit übernehmen, müssten sie auch unbezahlte Arbeit abgeben. Dazu gehöre es auch, die Männer in die Pflicht zu nehmen. „Wir Frauen wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei“, brachte es Leni Breymaier abschließend auf den Punkt.
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ausbauen
Der Bundestag hat am Donnerstag das Ganztagsfinanzierungsgesetz beraten. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025.
In Deutschland haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, sobald ihr Kind das erste Lebensjahr vollendet hat. Aber was passiert nach der Einschulung? Für Kinder im Grundschulalter besteht dieser Rechtsanspruch nicht. Eltern stehen mit der Einschulung ihres Kindes also plötzlich vor einem großen Problem: Sie müssen eine Betreuung für ihr Kind an den Nachmittagen nach Schulschluss organisieren. Das soll sich ändern. In ihrem Koalitionsvertrag haben SPD und CDU/CSU vereinbart, bis zum Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter einzuführen. Denn klar ist: Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter erhöht die Teilhabechancen und ermöglicht eine bessere individuelle Förderung der Kinder. Gleichzeitig unterstützen Ganztagsangebote die Eltern dabei, Beruf und Familie zu vereinbaren.
In den letzten Jahren haben die Länder zwar die Infrastruktur für Bildung, Betreuung und Erziehung deutlich ausgebaut. Allerdings reicht das Angebot noch nicht aus, um den Bedarf an ganztägigen Angeboten für Kinder im Grundschulalter zu decken. Hierfür braucht es einen bedarfsgerechten Ausbau von Hort- und Schulinfrastruktur in den Ländern und Gemeinden. Das jetzt im Bundestag beratene Ganztagsfinanzierungsgesetz legt hierfür die finanziellen Grundlagen, damit der Rechtsanspruch ab 2025 erfüllt werden kann. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bund ein Sondervermögen in Höhe von zwei Milliarden Euro – jeweils eine Milliarde Euro in den Jahren 2020 und 2021 – bereitstellt, um die Länder beim Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen und die Finanzierung des Ganztagsausbaus zu sichern.
Rechtsterrorismus bekämpfen
Welche Konsequenzen müssen wir aus dem rassistischen Terroranschlag von Hanau ziehen? Darüber hat der Bundestag am Donnerstag in einer vereinbarten Debatte beraten.
Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau hat Deutschland erschüttert. Die schrecklichen Morde haben uns allen auf bitterste Weise vor Augen geführt, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus deutlich ausgeweitet werden muss.
Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Die Anschläge in Hanau und in Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind Teile einer besorgniserregenden Entwicklung. Der Rechtsstaat muss mit all ihm zur Verfügung stehenden Mitteln rigoros gegen seine Feinde vorgehen. Rechte Gefährder müssen systematisch ins Visier genommen werden. Und Rechtsextremisten dürfen nicht in den Besitz von Waffen gelangen.
Rassistischer und rechter Terror
An erster Stelle müssten jetzt Trauer und Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer stehen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich in der Debatte. „Gleichzeitig müssen wir uns darüber klar werden, was die wachsende rassistische Gewaltbereitschaft für unser Land bedeutet und was wir dagegen tun müssen.“ Was in Hanau passiert sei, sei mehr als Totschlag: „Es ist Massenmord, es war rassistischer und rechter Terror.“
Der Täter von Hanau sei vielleicht ein Einzeltäter gewesen, aber er wurde getragen von einem System der Hetze, der Erniedrigung und der Anleitung zur Gewalt, sagte Rolf Mützenich. „Und diese Spur führt hinein in den Bundestag, die AfD ist der Komplize.“ Mit Blick auf die AfD-Fraktion sagte er: „Dort steht der Feind dieser Demokratie, und wir müssen das benennen.“
Demgegenüber stünden hingegen die ganz vielen Menschen, die sich einsetzten in den Dörfern, Gemeinden und Städten, betonte Rolf Mützenich. Das mache ihm Hoffnung. „Wir sind nicht die Wiederholung von Weimar, wir sind eine mutige Demokratie und es gibt genügend Beispiele, die das jeden Tag zeigen.“
„Wir nehmen den Kampf gegen rechts auf!“
Menschen, die nichts anderes im Sinn hatten als hier zu leben und Teil unserer Gesellschaft zu sein, sei unermessliches Leid zugefügt worden, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. „Das muss uns alle aufrütteln.“ Der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung in unserer offenen und friedlichen Gesellschaft, sagte sie und versicherte: „Wir nehmen den Kampf gegen diese Bedrohung auf!“
Einen Schwerpunkt will sie dabei auch auf den Kampf gegen Hass und Hetze im Netz legen. Über 70 Prozent der angezeigten Hassposts im Netz richteten sich gegen Migrantinnen und Migranten. „Wir dürfen nicht weiter zuschauen, dass diesen Worten Taten folgen.“ Es brauche harte Strafen und konsequente Verfolgung für jede Form der Gewalthetze. Das vom Bundeskabinett beschlossene Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität sei hier der erste Schritt, sagte Christine Lambrecht. „Unsere Demokratie ist wehrhaft, unser Rechtsstaat ist stark, aber er muss jeden Tag verteidigt werden.“
Bundestag berät über Lage in Syrien
Im syrischen Idlib entwickelt sich eine humanitäre Katastrophe. Der Bundestag hat am Donnerstag auf Antrag der Koalitionsfraktionen über die Eskalation in Idlib und die Folgen für Europa debattiert.
Rund drei Millionen Menschen leben in der Provinz Idlib in Syrien. Fast eine Million von ihnen sind auf der Flucht, seit das syrische Regime mit russischer Unterstützung mit der militärischen Offensive auf die Provinz begonnen hat. An der türkischen Grenze wachsen seitdem die Flüchtlingslager. Auch die Lage an der türkisch-griechischen Grenze hat sich in den vergangenen Tagen zunehmend angespannt. Der türkische Präsident Erdogan versucht damit, die EU unter Druck zu setzen. Schon seit längerem katastrophal sind die Zustände in den Aufnahmeeinrichtungen auf den griechischen Inseln.
„Die Vereinten Nationen sehen in der Situation in Idlib die größte humanitäre Katastrophe seit dem Beginn des Syrienkrieges“, sagte der Staatsminister im Auswertigen Amt Niels Annen im Bundestag. Insgesamt seien etwa eine Million Menschen auf der Flucht, davon achtzig Prozent Frauen und Kinder. Russland und die Türkei hätten gezeigt, dass sie bereit seien, ein sehr hohes Risiko einer militärischen Konfrontation einzugehen. Aber sie seien auch bereit, mit politischen Absprachen zu einer Deeskalation zu kommen. Er hoffe auf eine belastbare Vereinbarung über einen Waffenstillstand, sagte Niels Annen mit Blick auf die Gespräche zwischen dem türkischen und dem russischen Präsidenten.
Waffenruhe muss erster Schritt sein
„Das menschenverachtende Vorgehen des syrischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung muss umgehend aufhören“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich. Der erste Schritt, um die Lage zu verbessern, müsse eine Waffenruhe sein. Sie sei die Voraussetzung für einen politischen Prozess und für humanitäre Hilfe in Idlib.
Die Lage in Syrien sei dramatisch, sagte auch Lars Castellucci, migrationspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung musste das Land schon verlassen oder ist im Land auf der Flucht.“ Die Menschen in Syrien brauchten jetzt drei Dinge: Sicherheit, Versorgung und Sicherheit.
Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Frank Schwabe, betonte: „Wir müssen in Syrien als Friedensmacht auftreten und humanitäre Hilfe leisten.“ Gleichzeitig müsse die internationale Staatengemeinschaft deutlich machen, dass diejenigen, die in Syrien Kriegsverbrechen begingen, auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Europa muss Menschen in Griechenland helfen
Für die SPD-Fraktion ist klar: Europa und die internationale Staatengemeinschaft müssen schnell darauf reagieren und auch bereit sein, weitere humanitäre Hilfe für die Menschen in Idlib und die Geflüchteten in der Türkei zu leisten. In einem Beschluss vom 4. März fordert die SPD-Fraktion zudem, so schnell wie möglich zu einer europäischen Lösung für die Menschen in den griechischen Aufnahmeeinrichtungen zu kommen.
Schutz und humanitäre Hilfen
Die SPD-Fraktion spricht sich dafür aus, besonders schutzbedürftigen Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern auch in Deutschland Schutz zu gewähren. „Wir arbeiten derzeit mit voller Kraft an einer Lösung, an der sich nicht alleine
Deutschland, sondern wenigstens ein paar andere europäische Staaten beteiligen“, heißt es in einem Fraktionsbeschluss.
„Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung für die Menschen in Griechenland“, so die SPD-Fraktion. Die Zustände in den Aufnahmeeinrichtungen auf den griechischen Inseln seien katastrophal und untragbar. Die SPD-Abgeordneten fordern Bundesinnenminister Seehofer daher auf, in Brüssel für eine „Koalition der Vernunft“ zu werben und konkrete Maßnahmen zur gemeinsamen Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen auf den Weg zu bringen.
Mit Frankreich, Portugal, Finnland und anderen Ländern hat sich inzwischen eine Reihe von Staaten in einer humanitären Geste bereit erklärt, schutzbedürftige Kinder aufzunehmen. Auch in etlichen Bundesländern, Städten und Gemeinden gibt es die Bereitschaft, besonders Schutzbedürftige aufzunehmen. „Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft“, heißt es in dem Beschlusspapier der SPD-Fraktion. „Mit unserem gemeinsamen Handeln zur Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland machen wir einen ersten und notwendigen humanitären Schritt.“
Darüber hinaus spricht sich die SPD-Fraktion dafür aus, die Verhältnisse in den griechischen Hotspots dauerhaft zu verbessern. Ein Weg könnte sein, dem UN-Flüchtlingshilfswerk die operative Verantwortung zur Leitung der Flüchtlingszentren zu übertragen. Zudem setzen sich die SPD-Abgeordneten dafür ein, die humanitäre Hilfe für die Menschen in Idlib (Syrien) und für die Geflüchteten in der Türkei aufzustocken.
Neuausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik
Für eine grundsätzliche Lösung hält es die SPD-Fraktion für erforderlich, die europäische Flüchtlingspolitik und das gemeinsame Asylsystem neu auszurichten. In dem Fraktionsbeschluss heißt es dazu: „Wir müssen weg vom Prinzip der Zuständigkeit des Ersteinreisestaates. Wir brauchen eine gerechte und solidarische Verteilung geflüchteter Menschen auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten.“ Nur so sei dauerhaft eine Entlastung der Staaten an den EU-Außengrenzen und insbesondere auch Griechenlands zu erreichen.
Der Beschluss der SPD-Fraktion kann hier heruntergeladen werden:
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/griechenland.pdf
Afghanistan unterstützen
Die Bundeswehr soll sich weiterhin an der Nato-geführten Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsmission „Resolute Support“ in Afghanistan beteiligen. Das sieht ein Antrag der Bundesregierung vor, über den der Bundestag am Mittwoch erstmals debattiert hat.
Das gemeinsame Engagement der afghanischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft hat in den letzten Jahren trotz vieler Schwierigkeiten greifbare Ergebnisse hervorgebracht: Lebenswichtige Transport- und Versorgungsinfrastruktur wurde wieder hergestellt, das Bildungssystem und die Gesundheitsversorgung haben sich grundlegend verbessert, Frauen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle im öffentlichen Leben, und es gibt eine vielfältige Medienlandschaft sowie freie politische Debatten.
Allerdings sind auf all diesen Feldern weitere Anstrengungen nötig, damit Afghanistan den Rückstand aufholen kann, der in den Jahrzehnten bewaffneter Konflikte entstanden ist. Denn gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie brüchig bereits erzielte Fortschritte weiterhin sind. Die Regierung ist nicht in allen Landesteilen handlungsfähig; Korruption und Armut sind immer noch weit verbreitet.
Auftrag der Mission bleibt es deshalb, die Leistungsfähigkeit der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu erhöhen. Ziel ist es, die afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, die Sicherheitsverantwortung auf lange Sicht flächendeckend und eigenverantwortlich wahrzunehmen. Darüber hinaus sieht das Mandat vor, dass die Bundeswehr im Notfall auch Personal der internationalen Gemeinschaft, das im zivilen Wiederaufbau engagiert ist, unterstützen kann.
Die Bundesregierung beantragt, das Bundeswehrmandat bis zum 31. März 2021 zu verlängern. Eingesetzt werden sollen wie bisher bis zu 1300 Soldatinnen und Soldaten.
Mittelmeerraum stabilisieren
Die Bundeswehr soll auch weiterhin einen Beitrag zum Kampf gegen Terrorismus und Waffenschmuggel im Mittelmeer leisten. Über einen entsprechenden Antrag der Bundesregierung hat der Bundestag am Freitag beraten.
Rund ein Drittel aller über See verschifften Güter und ein Viertel aller Öltransporte weltweit werden durch das Mittelmeer geleitet. Daher ist die Sicherheit im Mittelmeerraum für die Nato und ihre Mitgliedsländer von zentraler Bedeutung. Fehlende staatliche Kontrolle über weite Küstenbereiche des Mittelmeerraumes und anhaltende politische Instabilität in einzelnen Staaten eröffnen terroristischen Organisationen jedoch Rückzugs- und Herrschaftsräume.
Der Antrag der Bundesregierung sieht daher vor, die Beteiligung der Bundeswehr an der Nato-geführten Maritimen Sicherheitsoperation „Sea Guardian“ um ein weiteres Jahr bis Ende März 2021 zu verlängern. Wie im vergangenen Jahr sollen bis zu 650 deutsche Soldatinnen und Soldaten daran mitwirken, Lagebilder zu erstellen und den Seeraum zu überwachen. Das Einsatzgebiet umfasst das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar und ihre Zugänge und den darüber liegenden Luftraum.
Der Antrag wurde wie üblich zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen.
Für eine Welt ohne Atomwaffen
Die SPD-Fraktion hat dem Vorschlag von Frankreichs Präsident Macron, über eine eigene atomare Verteidigung der Europäischen Union nachzudenken, eine klare Absage erteilt. „Mit aller Entschiedenheit wenden wir uns gegen verantwortungslose Gedankenspiele über die Schaffung einer europäischen Atomwaffenmacht“, heißt es in einem Fraktionsbeschluss vom Dienstag.
In dem Positionspapier bekräftigt die SPD-Bundestagsfraktion das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen. Keine andere sicherheitspolitische Bedrohung sei derart gravierend wie die Verbreitung und der Gebrauch von Massenvernichtungswaffen. Zu den wichtigsten Zielen sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik gehöre es daher, die Verbreitung und den Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen zu verhindern. „Unser letztendliches Ziel ist dabei die vollständige weltweite Abrüstung der bestehenden Arsenale von Massenvernichtungswaffen“, so der Beschluss. Die SPD-Fraktion unterstützt Außenminister Heiko Maas deshalb in seinen politischen Bemühungen um internationale Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung sowie die Ächtung neuartiger Waffensysteme.
Konkrete Fortschritte für nukleare Abrüstung müssten vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen und bei der anstehenden Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag erzielt werden. 50 Jahre nach Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrages, der unter anderem die Verbreitung von Kernwaffen verbietet, sollten sich die Vertragsstaaten aus Sicht der SPD-Fraktion auf eine neue Agenda für Abrüstung und Nichtverbreitung von Atomwaffen einigen. Ausdrücklich unterstützen die SPD-Abgeordneten entsprechende Bemühungen von Außenminister Heiko Maas im Vorfeld der Überprüfungskonferenz, die Ende April in New York beginnt. Außerdem setzt sich die SPD-Fraktion für eine starke, gemeinsame Position der Europäischen Union ein.
Darüber hinaus würdigt die SPD-Fraktion die Bedeutung des 2017 beschlossenen Atomwaffenverbotsvertrages, der wichtige Impulse für die Debatte zur weltweiten nuklearen Abrüstung gegeben habe. Jetzt komme es darauf an, sich konstruktiv mit den Argumenten und Intentionen des Atomwaffenverbotsvertrags unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure auseinanderzusetzen.
Die SPD-Bundestagsfraktion bekräftigt das Ziel, sogenannte autonome letale Waffensysteme international zu ächten. Letale Autonome Waffensysteme (LAWS) werden vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes definiert als „jedes Waffensystem mit Autonomie in den kritischen Funktionen der Zielauswahl und Zielbekämpfung“. Solche Systeme können folglich selbstständig und ohne menschliche Steuerung oder sogar Aufsicht darüber „entscheiden“, ob etwas oder jemand ein Ziel ist und wie und wann dieses Ziel bekämpft werden soll. Die SPD-Fraktion begrüßt, dass es im November 2019 nach schwierigen Verhandlungen zum ersten Mal gelungen ist, einen breiten internationalen Konsens über rote Linien für den Einsatz autonomer Funktionen in Waffensystemen zu erzielen: „Die Verabschiedung der Leitprinzipien durch die 125 Vertragsstaaten in der Waffenkonvention der Vereinten Nationen in Genf bringt uns unserem Ziel einer internationalen Ächtung vollautonomer letaler Waffensysteme einen großen Schritt näher.“
Das Positionspapier der SPD-Fraktion ist hier als Download zu finden:
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-abruestung-20200303.pdf
SPD-Fraktion schlägt Reform des Wahlrechts vor
Die SPD-Fraktion hat einen Vorschlag zur Änderung des Wahlrechts beschlossen. Ziel ist es, den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen und die Handlungsfähigkeit des Bundestages zu erhalten.
Der Deutsche Bundestag hat als direkt gewählte Volksvertretung eine hervorgehobene Bedeutung in unserer parlamentarischen Demokratie. Wie in keinem anderen Verfassungsorgan verkörpert sich in ihm das Leitprinzip des Grundgesetzes, wonach alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Seit 1949 ist der Bundestag in diesem Sinne der zentrale Ort, an dem die gesellschaftlich relevanten Themen und Probleme öffentlich debattiert werden, wo Gesetze beraten und beschlossen werden, wo der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin gewählt und die Regierung kontrolliert wird.
Die SPD-Fraktion will sicherstellen, dass der Deutsche Bundestag diese Aufgaben auch in Zukunft optimal erfüllen kann. Veränderungen der Parteienlandschaft und die Mechanismen des derzeitigen Wahlsystems könnten dazu führen, dass das Parlament nach der nächsten Bundestagswahl 750 oder 800 Sitze haben könnte. Die Soll-Größe liegt bei 598 Mandaten.
Um zu verhindern, dass der Deutsche Bundestag an die Grenzen seiner Arbeits- und Handlungsfähigkeit stößt, hält die SPD-Fraktion eine Reform des Wahlrechts für unabdingbar. Das Modell der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sieht vor, die Zahl der Abgeordneten nach der Bundestagswahl 2021 auf maximal 690 zu begrenzen. Um die Repräsentanz des Parlaments zu erhalten, soll es weiterhin 299 Wahlkreise geben. Die Regelgröße des Bundestags bleibt demnach bei 598 Abgeordneten. Um den Wählerwillen – also das Verhältnis der Zweitstimmen – nicht zu verzerren, werden Überhangmandate weiterhin durch Ausgleichsmandate kompensiert. Um die Obergrenze von 690 Mandaten einzuhalten, werden aber darüberhinausgehende Überhang- und Ausgleichsmandate nicht mehr zugeteilt. Um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen, schlägt die SPD-Fraktion außerdem vor, nur Parteien zur Bundestagswahl zuzulassen, deren Landeslisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt sind.
Die SPD-Fraktion sieht diesen Vorschlag ausdrücklich als Übergangsregelung für die nächste Bundestagswahl. In einem zweiten Schritt schlagen die SPD-Abgeordneten vor, eine Reformkommission aus Abgeordneten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Bürgerinnen und Bürgern einzusetzen, die sich mit Alternativen für eine Reform des personalisierten Verhältniswahlrechts auseinandersetzt und Empfehlungen zur Modernisierung der Parlaments- und Wahlkreisarbeit, zur Dauer der Legislaturperiode und zur gleichberechtigten Repräsentanz von Frauen und Männern im Bundestag erarbeitet.
Der Beschluss der SPD-Fraktion kann hier heruntergeladen werden:
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/beschluss-wahlrecht-spd-20200303.pdf
Höhere Sicherheit bei Medizinprodukten
Die Koalition verbessert die Sicherheit von Medizinprodukten und Arzneimitteln für die Patientinnen und Patienten. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen.
Das nationale Medizinprodukterecht wird an die EU-Medizinprodukteverordnung sowie an die EU-Verordnung über In-Vitro-Diagnostik angepasst. Die Koalition schafft damit die Voraussetzungen dafür, dass die erhöhten Anforderungen der EU-Verordnungen an die Identifizierung, die Zertifizierung und die Registrierung von Medizinprodukten sowie an die Marktüberwachung in Deutschland fristgerecht umgesetzt werden können. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kann künftig bei Gefahr im Verzug oder wenn der Hersteller seinen Sitz im Ausland hat unmittelbar selbst die notwendigen Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit von Patientinnen und Patienten anordnen. Damit werden die Befugnisse der Länderbehörden sinnvoll ergänzt.
Außerdem wird die internationale Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen gestärkt. Hierzu wird die sogenannte „Medicrime“-Konvention des Europarates umgesetzt.
Schutz vor Konversionsbehandlungen
Therapien zur „Heilung“ von Homosexualität bei Minderjährigen und beschränkt einwilligungsfähigen Personen sollen verboten werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Schutz vor Konversionsbehandlungen hat der Bundestag am Freitag in erster Lesung beraten.
Bei sogenannten Konversionstherapien handelt es sich um Behandlungen, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder selbstempfundene geschlechtliche Identität eines Menschen zu ändern oder zu unterdrücken.
Der Gesetzentwurf sieht vor, Minderjährige und nur beschränkt einwilligungsfähige Personen vor solchen Therapien zu schützen. An ihnen sollen Konversionstherapien künftig nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Denn mit solchen Therapien wird in die sexuelle und geschlechtliche Entwicklung und Selbstbestimmung der Betroffenen eingegriffen und ihre Gesundheit geschädigt. Auch das öffentliche Werben, Anbieten und Vermitteln von Konversionstherapien soll mit dem Gesetz verboten werden.
Ehrenamt beim THW stärken
80.000 Helferinnen und Helfer engagieren sich beim Technischen Hilfswerk (THW) ehrenamtlich für den Zivil- und Katastrophenschutz. Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung die Attraktivität dieses Ehrenamtes stärken.
Den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des THW-Gesetzes hat der Bundestag jetzt in erster Lesung beraten. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Regelungen des THW-Gesetzes zu aktualisieren und mit rechtlichen Verbesserungen im Ehrenamt zu verbinden.
Neue Gefahren wie etwa die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen oder der Klimawandel führen zu veränderten Rahmenbedingungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Das THW stellt sich diesem Wandel, in dem es beispielsweise seine technischen Fähigkeiten erweitert oder seine technischen und logistischen Strukturen modernisiert. Die Modernisierung des THW-Gesetzes soll diesen Entwicklungen Rechnung tragen. Außerdem sollen unter anderem Freistellungsregelungen zur Förderung der Helferinnen und Helfer verbessert werden.
Muslime in Deutschland: Mittendrin statt nur dabei!
Am Mittwoch hat die SPD-Bundestagsfraktion mehr als 200 engagierte Mitglieder der muslimischen Community aus allen Teilen der Republik zu der zweiten Islamkonferenz unter dem Motto „Muslime in Deutschland – Mittendrin statt nur dabei!“ empfangen.
Ziel war es, nicht ÜBEREINANDER, sondern MITEINANDER zu sprechen und sich über aktuelle Herausforderungen auszutauschen. Die Abgeordneten der SPD-Fraktion haben gegenüber den muslimischen Gästen sehr deutlich gemacht, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten – schon immer, aber jetzt erst recht – mit aller Entschiedenheit gegen Islamfeindlichkeit kämpfen und sich für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft einsetzen, an der Musliminnen und Muslime gleichberechtigt teilhaben. Der regelmäßige Austausch mit ihnen ist den SPD-Abgeordneten sehr wichtig, denn Musliminnen und Muslime und ihre Religion gehören zu Deutschland.
Die sozialdemokratischen Abgeordneten haben die Islamkonferenz genutzt, um ihnen vor allem zuzuhören. Insbesondere nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, wollen sie ein klares Signal setzen und zeigen: Wir sind an Eurer Seite!
Mehr als 200 Musliminnen und Muslime aller Altersgruppen aus ganz Deutschland hatten sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Nach einer abwechslungsreichen Podiumsdiskussion haben sie in verschiedenen Diskussionsforen mit den Abgeordneten über ihre Erfahrungen im Alltag gesprochen, haben berichtet, wo der Schuh drückt, und ihre Erwartungen an die Politik formuliert. Den Wünschen und Vorschlägen für ein besseres Miteinander will sich die SPD-Bundestagsfraktion annehmen.
Information für die Menschen am Hochrhein und im Hochschwarzwald

Ergebnis des Koalitionsausschusses zum Kurzarbeitergeld

Für schnelles Internet fließen 8,7 Millionen Euro nach Klettgau

Internationaler Frauentag – „Viel erreicht, aber noch längst nicht am Ziel“

Hochrheinkommission gewinnt Bundeswettbewerb für vorbildliche Bürgerbeteiligung

Islamkonferenz der der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin

Gespräch zur Verkehrsentlastung rund um den Zollhof Waldshut

Jahrzehntelange kommunale Arbeit des Genossen Dieter Schwandt

Schnelles Internet im Hochschwarzwald: Rund 626.000 Euro Bundesfördermittel fließen

„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ – mehr Geld für Hilfs- und Beratungsangebote in den Kommunen

Schnelles Internet: 3 Millionen Euro Bundesfördermittel fließen nach St. Märgen

Ein Atomkraftwerk weniger an der deutsch-französischen Grenze

Oberried im Glück: 7,6 Millionen Euro Fördermitteln für den Breitbandausbau

Gesetzentwurf zur Grundrente – ein Meilenstein in der Geschichte unseres Sozialstaates

2,5 Millionen Euro Bundesfördermittel fließen nach Oberried
Ergebnis des Koalitionsausschusses zum Kurzarbeitergeld
/in Allgemein /von ArchivEine begrüßenswerte, wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen das Coronavirus
Die Bundesregierung handelt rechtzeitig und entschlossen in der Coronavirus-Krise. Mit den Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld wollen wir Arbeitsplätze erhalten und schaffen Planungssicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Davon werden im Ernstfall insbesondere die zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort profitieren, die das Rückgrat der südbadischen Wirtschaft bilden.
Konkret wurde vereinbart, befristet bis Ende 2021 Verordnungsermächtigungen einzuführen, mit der die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld absenken und die Leistungen wie folgt erweitern kann:
- Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, auf bis zu 10 %
- Teilweise oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
- Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer
- Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit.
Foto: Pixabay




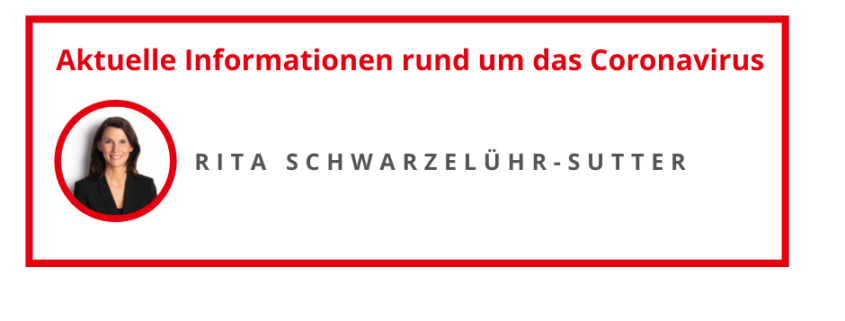


 Titlfoto: Pixabay
Titlfoto: Pixabay KDFB
KDFB

